Aktuelle Andachtseite - ev-luth-kirchengemeinden-salzgitter-thiede+immendorf
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinden Salzgitter Thiede und Salzgitter Immendorf

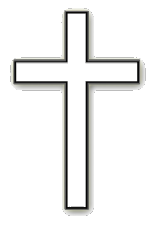
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinden
Salzgitter Thiede und Salzgitter Immendorf
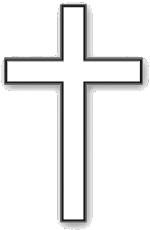
Hauptmenü:
Aktuelle Andachtseite
Immendorf
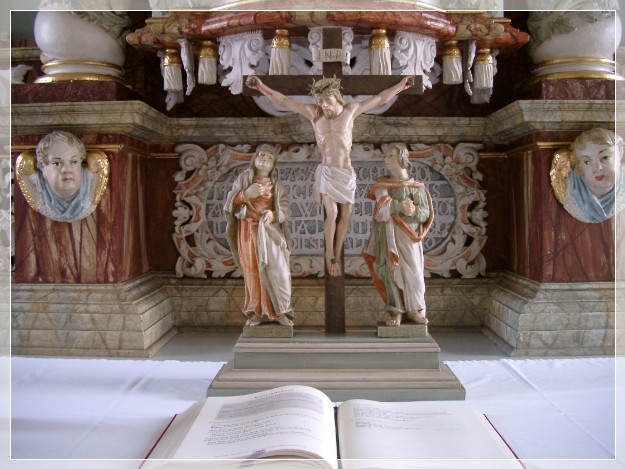
Andacht Januar 2026Herausforderungen oder Glück und Freude? Wir können es nicht wissen. Vermutlich ist von allem etwas dabei. Wir müssen es auf uns zukommen lassen. Ich frage mich, welche Richtung ich einschlagen soll. Wo kann ich Orientierung finden? Ich bin auf einem Weg unterwegs. Ein gepflasterter Fußweg, rechts und links wächst Rasen. Der Weg leitet mich, hat eine leicht geschwungene Form. Doch er endet plötzlich. Ein Kantstein als Begrenzung und eine schmale Straße ohne Fußweg kreuzen meinen Weg. Auf die Straße ist ein Verkehrszeichen gemalt. Ein großes rundes Symbol, blauer Grund mit einem weißen Pfeil darauf. Aus meiner Perspektive zeigt dieser Pfeil nach rechts oben. Das Verkehrszeichen gibt die vorgeschriebene Fahrtrichtung an. Es soll der Kollision mit einem Hindernis vorbeugen. Ich könnte dem auch zu Fuß folgen. Doch der Pfeil zeigt auf einen frisch aufgeschütteten hohen Erdwall, der aussieht wie ein Deich an der Küste. Direkt auf das Hindernis vor mir zu. Darüber ist Himmel zu sehen, sonst nichts.Was für eine trostlose Einladung, dieser Richtung zu folgen. Ich stelle mir vor, unter diesem Bild steht die Jahreslosung für 2026: Gott spricht: Siehe ich mache alles neu! AMENWorte aus der Offenbarung des Johannes. Geschrieben vor langer Zeit für Christen, die unter der Verfolgung des Römischen Reichs gelitten haben. Eine Trostschrift. Ich stehe auf dem gepflasterten Weg, das Verkehrszeichen vor Augen, und der kahle Erdwall türmt sich als Grenze vor mir auf. Hier ist der Weg zu Ende, denke ich. Der weiße Pfeil auf blauem Grund scheint mir zuzurufen: Komm, geh weiter! Es ist nicht so, wie es scheint. Komm nur, ich mache alles neu, ruft Gott mir zu. So wie damals den Christen, die unter der Verfolgung gelitten haben. Gott wird seine Hütte bei den Menschen haben. Sie werden ein Volk sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und es wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Denn das erste ist vergangen. In meinen Gedanken folge ich dem Pfeil. Gehe den kahlen Erdwall hinauf.Erde ist die Grundlage für Wachstum. Die kahle Erde ist eben, wie zur Aussaat vorbereitet. Hier kann alles neu wachsen und grünen. Neues Leben und Hoffnung auf eine friedliche Umgebung, in der alle wachsen können. Nach dem Grün kommt auch anderes Leben dazu. Ich denke, wie sehr unsere Welt gerade solch eine Hoffnung und Trost braucht. Menschen leben in Konflikten, die sich scheinbar nicht lösen lassen. Auf persönlicher Ebene, aber besonders denke ich an die Kriege, Verfolgung und Gewalt in der Welt. Gott spricht: Siehe ich mache alles neu! In Gedanken gehe ich weiter den Wall hinauf. Inzwischen ist er üppig grün und die ersten Blumen blühen. Vögel sind unterwegs, und Schafe weiden zu meinen Füßen. Ich hole tief Luft, komme oben an. Mein Blick geht in die Weite. Blauer Himmel, weiße Wolken spannen sich über mir aus. Ich blicke auf grüne Wiesen, eine Küste und das Meer. Weit wird mein Blick auf den Horizont gezogen. Da hinten geht es immer weiter. Nichts scheint mehr den Weg zu versperren, alles ist möglich. So blicke ich mit Hoffnung und Zuversicht auf das neue Jahr. Es fühlt sich jetzt noch schwer an, und die Sorgen verschwinden nicht einfach. Ich weiß aber, daß es nicht so bleiben wird. Gott wird abwischen alle Tränen. Das erste ist vergangen, Gott macht alles neu. Die Worte begleiten mich und lassen in mir Freude wachsen und den Mut, weiterzugehen in das und durch das neue Jahr 2026.AMENDiese Andacht ist konsequenterweise in alter Rechtschreibung verfaßt!

Andacht Dezember 2025
Draußen ist es finster. Wärme strahlen nur die Punschstände ab und Kerzenlicht macht es heimelig in unseren Zimmern. Wir gehen auf das Solstitium zu, den kürzesten Tag, den Moment des Stillstands der Sonne, die sich wie ein Pendel nun wendet, um neu aufzugehen. Dieses Phänomen haben viele Völker und Religionen seit alters mit unterschiedlichen Festen begangen. Denn immer schon sehnen sich die Menschen nach Frieden und Gerechtigkeit, nach Licht und Wärme, nicht erst seit den Turbulenzen der letzten Jahre, nicht erst seit dem Morden im NS-Regime. Welche Metapher würde sich da für Gott näherlegen als die Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit und des Heils, des Friedens und der Erneuerung. Genau davon erzählt das Buch Maleachi fast ganz am Ende der Prophetenworte unserer Bibel. Genau davon zeugt auch unser diesjähriger Monatsspruch im Dezember. Dort steht: Gott spricht: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, sollaufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. (Mal. 3,20) Diese Bild ist vermutlich den meisten nicht durch Maleachi, den wenig bekannten 12. kleinen Propheten, vor Augen, sondern durch das Lied, das Otto Riethmüller 1932 aus unterschiedlichen Quellen zusammengestellt hat: „Sonne der Gerechtigkeit“. Er hat es als Weckruf verstanden in Zeiten des Erstarkens des nationalsozialistischen Gedankenguts, in Zeiten, in denen die Gottlosigkeit überhand zu nehmen drohte. Ähnlich der Prophet Maleachi. Er beklagt, daß die heiligen Riten nicht ordnungsgemäß eingehalten werden und ein sittlicher Verfall auszumachen ist, ja daß sogar der Nutzen des Dienens für Gott insgesamt hinterfragt wird. „Was bringt es, daß wir den Dienst für ihn verrichten und daß wir mit Trauermiene umherlaufen?“ Kennen wir das nicht auch? Wenn jemand fragt, was bringt dir dein Glaube, sind wir oft um eine Antwort verlegen. Und manchmal würden wir am liebsten ausbrechen aus den eigenen Vorsätzen. Dazu kommt damals wie heute mitunter auch ein Versagen der offiziellen Kirchen und aller, die Gott dienen. Alles in allem: Das Pendel ist am Anschlag, es muß Neues geschehen, damit nicht alles untergeht. Maleachi läßt die Menschen nicht in der Finsternis stehen. Er spricht vom Herrn der Herrlichkeit und kündet Zukunft: „Ich schicke meinen Boten. Er soll mir den Weg bereiten.“Welch vertraute Worte. Immer wieder redet Gott so zu seinen Menschen. Maleachi, vermutlich bedeutet sein eigener Name „Bote“, bezeichnet den Kommenden als den „Engel des Bundes“, als Boten Gottes, als Vollstrecker des Gerichts. Doch diese Vorstellung widerstrebt uns. Gericht? Obwohl wir ähnliche Bilder von Johannes dem Täufer kennen, dem letzten aller Propheten.Aber Ge-Richt, das bedeutet eigentlich ausrichten, gerade richten, wieder auf Schiene bringen, daß die Dinge richtig laufen. Und dazu sendet Gott seinen Boten, der eine frohe, helle, leuchtende Zusage mitbringt. „Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.“ Die geflügelte Sonne war damals im gesamten orientalischen Raum das Zeichen für Heil und Segen, ein Schutzzeichen, eine Himmelsbotschaft. So bleibt die Frage: Was bringt mir mein Glaube? Unter anderem, daß ich dieses Zeichen erkennen kann, daß ich in der Finsternis der Tage schon das strahlende Weihnachtslicht erblicken kann; daß ich auf den Flügeln der Sonne der Gerechtigkeit erwartungsvoll und getrost dem aufgehenden Licht entgegenwarten kann. Und daß ich nicht nur mit Otto Riethmüller einstimmen kann, sondern auch in dem Weihnachtslied EG 40 mitbitten kann:„Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne,bestrahle mich mit deiner Gunst;dein Licht sei meine Weihnachtswonneund lehre mich die Weihnachtskunst,wie ich im Lichte wandeln sollund sei des Weihnachtsglanzes voll.“Diese Andacht ist konsequenterweise in alter Rechtschreibung verfaßt!
